|

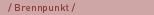
 Afrika
Afrika
 Balkan
Balkan
 China / Russland
China / Russland
 Europa
Europa
 Internationales
Internationales
 Politik in Deutschland
Politik in Deutschland
 Politik und Wirtschaft
Politik und Wirtschaft

 Lehrredaktion
Lehrredaktion
 e-Demokratie
e-Demokratie
 Medien
Medien
 Extremismus im Netz
Extremismus im Netz

 TV / Hörfunk-Tipps
TV / Hörfunk-Tipps
 Pop & Politik
Pop & Politik

 Sport
Sport
 Satire
Satire
 Netz-Fundstücke
Netz-Fundstücke


 Außenpolitik der BRD
Außenpolitik der BRD
 Europäische Union
Europäische Union
 Theorien
Theorien
 Organisationen
Organisationen
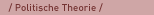
 Antike
Antike
 Neuzeit
Neuzeit

 Parteien
Parteien
 Institutionen
Institutionen

 Aus den Hochschulen
Aus den Hochschulen
 Studienhilfen
Studienhilfen
 Für Studenten
Für Studenten




 Über uns
Über uns
 Presse / Referenzen
Presse / Referenzen
 Redaktion
Redaktion
 Gästebuch
Gästebuch
 Impressum
Impressum

 Jobs@e-politik.de
Jobs@e-politik.de
 Werbung
Werbung
 Partner
Partner
|
Der Deutsche Bundestag
Autor : Politisches Studium
E-mail: redaktion@e-politik.de
Artikel vom: 12.01.2000
Was die Erste Kammer darf und wie sie aufgebaut ist.
Definition und Grundzüge einer parlamentarischen Demokratie:
- Parlament und Regierungswahl in einem Wahlgang (Abberufbarkeit)
- keine Inkompatibilität von Regierungsamt und Bundestagsmandat
- geteilte Exekutive: Bundeskanzler und Bundespräsident
- Regierung und Parlamentsmehrheit vs. Opposition
A. Organisation des Bundestages
1. Abgeordnete
- Vertreter des Volkes
- nicht weisungsgebunden
- Indemnität (freies Rederecht)
- Immunität (Strafverfolgung nur mit Bundestagsgenehmigung)
2. Fraktion
- Vereinigung von mindestens 5% der Bundestagsabgeordneten einer Partei mit gleichgerichteten Zielen und die in keinem Bundesland in Konkurrenz stehen
- Organisation: Arbeitskreise/ -gruppen, da Arbeit in der Vollversammlung nicht machbar ist
- Gruppe: Zusammenschluß von Bundestagsmitgliedern, die die Fraktionsmindeststärke nicht erreichen
3. Ausschüsse
- wesentlich vorbereitendes Beschlußorgan für die Entscheidungen des Bundestages
- Hauptaufgabe: Beratung über Gesetzesvorlage und Kontrolle der Regierung
- Ausschußtypen: ständige Ausschüsse, Sonderausschüsse, Untersuchungsausschüsse, Enquete-Kommission (bis zu 9 Experten, die nicht aus dem Bundestag sein müssen), sonstige Gremien, Kommission (Vermittlungsausschuß, Wahlausschuß, parlamentarische Kontrollkommission)
4. Plenum
- Arbeits- und Redeparlament
- Entscheidungen, die in Ausschüssen und Fraktionen gefallen sind, werden im Plenum nachvollzogen und durch Abstimmung ratfiziert
- "Forum der Nation": Öffentlich
5. Bundestagspräsident
- Wahl zu Beginn der Legislaturperiode; kann nicht abgewählt werden
- Aufgaben: Einberufung und Leitung der Bundestagssitzung, Repräsentation des Bundestages nach außen, oberster Dienstherr der Bundestagsverwaltung, Hausrecht
6. Ältestenrat
- unterstützt Bundestagspräsidenten bei der Arbeit
- kein Beschlußorgan
B. Aufgaben des Bundestages
1. Wahlfunktion
- Wahl des Bundeskanzlers
- Wahl der Hälfte der BVG-Richter
- Wahl des Wehrbeauftragten
- Wahl des Präsidenten des Bundesrechungshofes (auf Vorschlag der Regierung)
- In der Bundesversammlung: Wahl des Bundespräsidenten
2. Gesetzgebungsfunktion
- Man unterscheidet ausschließliche Gesetzgebung, konkurrierende Gesetzgebung, Rahmengesetzgebung
- Mitwirkung des Bundesrates bei Gesetzesverabschiedungen: zustimmungspflichig, nicht zustimmungspflichtig (Einspruchsgesetz)
3. Kontrollfunktion
- Kontrolle der Regierung
- politische Richtungskontrolle, Effizienzkontrolle, Rechtskontrolle
- Kontrollinstrumente: Klage vor dem BVG, Große und Kleine Anfrage, Fargestunde und Aktuelle Stunde, Parlamentarische Untersuchungsausschüsse
- Kontrollen können nur stichprobenartig durchgeführt werden
4. Artikulationsfunktion
- Interessenswahrnehmung und -vertretung des dt. Volkes
- Aufzeigen von Alternativen
5. Willensbildungsfunktion
- politische Orientierung soll gegeben werden
- Plenardebatten: wichtigste Probleme des Landes kommen zur Sprache, Entscheidungshilfen zur Wahl
Die ersten beiden Funktionen sind vor allem Instrumente der Mehrheit, die Funktionen 3 und 4 werden dagegen hauptsächlich von der Opposition übernommen.
C. Aufgaben und Organisation der Bundesregierung
Die Regierung besteht aus dem Kanzler und den Ministern. Der Kanzler wird mit absoluter Mehrheit vom Bundestag gewählt und ernennt anschließend die Minister.
Der Regierung unterliegt die Staatsführung
Steuerungsfunktion: Sie stellt Regierungsprogramme auf und verwirklicht diese
Durchführungsfunktion: Sie ist beteiligt an der Ausführung von Bundesgesetzen
Die Arbeit der Regierung ist im wesentlichen nach vier Prinzipien organisiert, wobei die Grenzen zwischen den einzelnen Prinzipien vor allem vom Durchstzungsvermögen der beteiligten Personen abhängen:
1. Kanzlerprinzip
- Recht und Pflicht der Kabinnetssbildung (Organisationsgewalt)
- Richtlinienkompetenz
- konstruktives Mißtrauensvotum und Vertrauensfrage
- Chef des Bundeskanzleramtes, des Presse- und Informationsdienstes, des Bundesnachrichtendienstes
2. Kabinettsprinzip
- Kabinett besteht aus Kanzler und Ministern: Ministerübergreifendes Entscheidungszentrum mit dem Recht der gesetzesinitiative (nur Kabinett kann GI unternehmen)
- Beschlußfähig bei Anwesenheit des Kanzlers und der Hälfte der Minister (Minister können sich durch parlamentarische Staatssekretäre vertreten lassen, die aber nicht stimmberechtigt sind)
- Beratung und Beschluß von allgemeinen, innenpolitischen, außenpolitischen, wirtschaftlichen, sozialen, finaziellen und kulturellen Angelegenheiten
3. Ressortprinzip
- Ministerien auf der Basis des gesamten Regierungsapparates
- Minister ist selbstständig und eigenverantwortlich
- Ressortaufteilung in Abteilungsphase, Fachabteilung, Referate
4. Koalitionsgespräche und -runden
- informelles Treffen von Kabinettsmitgliedern und Fraktionsspitzen
- keine verbindliche Entscheidungen
- effektivere Arbeit als im Kabinett, da nur hochrangige Themen ohne Geschäftsordnung (also ungezwungen) behandelt werden und sogar die Opposition miteinbezogen werden kann.
D. Die BRD - Eine Kanzlerdemokratie ?
Verfassungsgrundlagen: Das GG legt bestimmte Vorschriften fest, die Bedingungen für eine Kanzlerdemokratie sind aber nicht nur vom GG abhängig und ändern sich laufend.
Alleiniges Recht der Kabinetts- und Ressortbildung
Was ist Kanzlerdemokratie?
- Untersuchung der verfassungsrechtlichen und faktischen Stellung eines starken Kanzlers
- Begriff entstand unter Adenauer: Orientierungsrahmen für die Nachfolger
- Kanzlerdemokratie baut auf Regierungstechnik und Öffentlichkeit auf
- Kanzlerdemokratie ist eine Form des Zusammenwirkens zwischen Ebenen der Regierung, der Parteien und der Wähler
Charakteristik der Kanzlerdemokratie:
- Dominanz des Kanzlerprinzips über Ressort- und Kabinettsprinzip
- persönliches Prestige des Kanzlers im Regierungslager und bei den Wählern (Kanzlerbonus)
- Vereinigung des Amts des Bundeskanzlers und der Führung der Regierungspartei
- Engagement des Bundeskanzlers in der Außenpolitik
Diskussionspunkte:
- Weitere Aufgaben des Kanzlers: führen, koordinieren, integrieren, zusammenfügen
- Regeiren kann kein "Ein-Mann-Geschäft" sein
- Begriff sicherlich zutreffend, aber nie ausreichend
- Entscheidend: Verfassungsrechtlich unverbindliche Konventionen (mehr als GG)
E. Der Gesetzgebungsprozeß
Verfahren, die dem Gesetzgebungsprozeß vorausgehen:
- Innergouvernementaler Entscheidungsprozeß: Referat erarbeitet Gesetzesentwurf, Stellungnahmen anderer Gruppen innerhalb des Ressorts, Minister übernimmt den Entwurf, Beschluß des Kabinetts führt dann zu einer Regierungsvorlage
- Zum Teil gehen Gesetzesinitiativen auch direkt (und nicht auf Weisung der Politik) von der Ministerialbürokratie aus (vor allem bei Themen abseits des öffentlichen Interesses, Routineverfahren)
- Dominanz der Gesetzesinitiative seitens der Regierung aufgrund der politischen Handlungseinheit Regierung-Mehrheitsfraktion
Eigentlicher Gesetzgebungsprozeß:
- Initiativphase:
Einbringung des Gesetzesvorschlages seitens der Regierung, des Bundesrates oder 5% der Bundestagsabgeordneten
- Beratungsphase:
Stellungnahme des Bundesrates, Stellungnahme der Bundesregierung, Lesung/ Beratung im Bundestag mit anschließender Ausschußarbeit
- Beschlußphase mit Vermittlung:
Zustimmung bedeutet Billigung, keine Zustimmung führt entweder zur Nichterledigung oder der Anrufung des Vermittlungsausschusses (bei Zustimmungsgesetzen). Anschließend wird nochmal abgestimmt.
- Inkraftsetzung:
Unterzeichnung des Bundeskanzlers und des zuständigen Ministers, Verkündung im Bundesgesetzblatt
Der Bundestag ist eine Mischform zwischen reinen Rede- und Arbeitsparlamenten!
Rolle der Ausschüsse:
- greift nach der 1. Lesung im Parlament ins Geschehen ein.
- Bearbeitet Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Regierungslagers und auch oppositionelle
- Häufig Veränderungen in Nebensächlichkeiten
- Anhörung von Sachverständigen
- Einwirkungschance von Opposition und einzelnen Abgeordneten
Grenzen parlamentarischer Entscheidung:
- Haushaltsrecht (Vetorecht der Bundesregierung)
- Internationale Beziehungen: Regierung hat das Recht, internationale Verträge zu unterzeichnen; Parlament kann nur ratifizieren
- Fall der Handlungsunfähigkeit: Gesetzgebungsnotstand kann zur Umgehung des Parlaments führen
- Verteidigungsfall: Gemeinsamer Ausschuß
- EU-Beschlüsse
Dieses studentische Skript erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist keine Garantie zum Bestehen irgendwelcher Prüfungen. e-politik.de ist bemüht, die Skripten ständig zu aktualisieren und inhaltlich zu bearbeiten.
|
|
|

|
|
|

 Suche:
(Hilfe) Suche:
(Hilfe)
 Netzreportagen Netzreportagen
 Deutschland Deutschland
 Europa Europa
 USA USA
 Andere Länder Andere Länder
 Organisationen Organisationen
 Medien Medien
 Gesellschaft Gesellschaft
 Studium Studium
 LINKS der WOCHE LINKS der WOCHE








|


