|

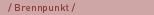
 Afrika
Afrika
 Balkan
Balkan
 China / Russland
China / Russland
 Europa
Europa
 Internationales
Internationales
 Politik in Deutschland
Politik in Deutschland
 Politik und Wirtschaft
Politik und Wirtschaft

 Lehrredaktion
Lehrredaktion
 e-Demokratie
e-Demokratie
 Medien
Medien
 Extremismus im Netz
Extremismus im Netz

 TV / Hörfunk-Tipps
TV / Hörfunk-Tipps
 Pop & Politik
Pop & Politik

 Sport
Sport
 Satire
Satire
 Netz-Fundstücke
Netz-Fundstücke


 Außenpolitik der BRD
Außenpolitik der BRD
 Europäische Union
Europäische Union
 Theorien
Theorien
 Organisationen
Organisationen
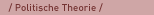
 Antike
Antike
 Neuzeit
Neuzeit

 Parteien
Parteien
 Institutionen
Institutionen

 Aus den Hochschulen
Aus den Hochschulen
 Studienhilfen
Studienhilfen
 Für Studenten
Für Studenten




 Über uns
Über uns
 Presse / Referenzen
Presse / Referenzen
 Redaktion
Redaktion
 Gästebuch
Gästebuch
 Impressum
Impressum

 Jobs@e-politik.de
Jobs@e-politik.de
 Werbung
Werbung
 Partner
Partner
|
Die Europäische Union - Osterweiterung
Autor : Politisches Studium
E-mail: redaktion@e-politik.de
Artikel vom: 14.02.2000
Dieses Skript beschäftigt sich mit den wesentlichen Fragen und dem Fahrplan zur Osterweiterung der Europäischen Union. Das Skript diskutiert keine aktuellen Entwicklungen!
1. Allgemeines – Europa an der Schwelle zum nächsten Jahrtausend
-
Die EU ist entsprechend ihren Zielen und nach ihrer Vertragsverfasuung
auf Erweiterung ausgerichtet (keine Festung Europa)
-
Erweiterung und Vertiefung der EU: Dieser Zielkonflikt kann durch einen
gesteuerten und abgestuften Erweiterungsprozeß angegangen werden.
-
Notwendigkeit von Reformen vor der Osterweiterung
2. Fahrplan zur Osterweiterung
Kriterien für einen Beitritt zur EU
-
Gewähr für eine demokratische und rechtsstaatliche Ordnung im
Innern des Staates
-
Wahrung der Menschenrechte und des Schutze von Minderheiten
-
Funktionsfähige Marktwirtschaft
-
Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb
der EU standzuhalten
-
Verpflichtungen übernehmen
-
Übernahme der Ziele der Politischen und der Wirtschafts- und Währungsunion
Europaabkommen mit den beitrittswilligen Ländern
-
Inkrafttreten des Europaabkommens mit Polen: 01.02.1994
-
Inkrafttreten der Assozierungsabkommen mit Rumänien, Bulgarien, Tschechischer
Republik und der Slowakei am 01.02.1995
-
Beitritt zur EU bei Erfüllung der wirtschaftlichen und politischen
Bedingungen
-
Bis dahin volle Beteiligung am europäischen Integrationsprozeß
im politischen, wirtschaftlichen und handelspolitischen Bereich
-
Unterstützung der Europa-Abkommen durch das PHARE-Hilfsprogramm der
EG und durch die Aktivitäten der Osteuropabank
Regierungskonferenz in Turin am 29. März 1996
-
Reform des Maastrichter Vertrages
-
Vorbereitung auf die Osterweiterung der EU
-
Demokratischere, bürgernähere und effizientere Gestaltung der
inneren EU-Struktur
-
Verstärkte Integration der Menschen- und Grundrechte in die Verträge
-
Mehr Beachtung für den Umweltschutz
-
Schaffung eines hohen Beschäftigungsniveaus
-
Stärkung der Handlungsfähigkeit der GASP und deren Außenvertretung
-
Europa der zwei Geschwindigkeiten (nicht alle beitrittswillige Staaten
können und werden gleichzeitig aufgenommen werden)
3. Herausforderungen und Gefährdungen
Finanzierungsprobleme
Agrarpolitik
-
MOE-Länder sind potentielle Überschußländer im Agrarsektor
-
Reform notwendig, denn dieser Faktor würde den Finanzrahmen der EU
sprengen; es käme zu einer inflationsartigen Ausweitung des EU-Haushaltes
und der Finanzbeiträge der bisherigen Mitgliedsstaaten, so daß
bisherige Nettoempfänger sogar zu Zahlern werden würden.
Mit der Agenda 2000 wurde der Versuch übernommen den bisherigen
Reformweg fortzusetzen und eine Lösung für die Agrarwirtschaft
zu finden, um den Finanzierungsproblemen, die schon jetzt bestehen, Herr
zu werden.
Institutionelles Gefüge
-
ursprüngliches Gleichgewicht zwischen kleinen und großen Staaten
mit der Osterweiterung nicht mehr haltbar
-
Ersetzen des bisher praktizierten alphabetischen Rotationsprinzips bei
der Zusammensetzung des Ratsvorsitzes durch eine Troika
-
Suche nach einer Konstruktion bezüglich der Stimmengewichtung im Rat
zur Vermeidung einer entscheidungsbestimmenden Koalition aus Kleinstaaten
-
Begrenzung der Anzahl der Europa-Abgeordneten im Europäischen Parlament
auf 700 mit der Folge der Über- bzw. Unterrepräsentation
-
Übergang vom Prinzip der Einstimmigkeit bei Entscheidungen des Ministerrates
zum Prinzip der Mehrheitsentscheidungen
Innen- und Rechtspolitik
-
Möglichkeit einer Überführung der Innen- und Rechtspolitik
von der reinen zwischenstaatlichen Zusammenarbeit zu einer verstärkten
Koordination und letztendlich in die Zuständigkeit der Union
Neue europäische Sicherheitsstruktur
-
Da nicht alle Staaten der EU in der NATO sind, wird eine andere Form der
europäischen Sicherheitspolitik nötig. Eine Möglichkeit
wäre ein Ausbau der WEU.
Gefährdung der Kooperation und Kohäsion
-
Stärkung der zentrifugalen Kräfte
Funktionale Überdehnung
-
Vielschichtigkeit der Interessen der Bürger
-
Verteilungskonflikte, Auseinandersetzungen um die Durchsetzung konkurrierender
gesellschaftlicher Präferenzen -> tendenzielle Schwächung der
Entscheidungsfähigkeit
-
Überforderung der Institutionen der EU und somit geringere Problemlösungsfähigkeit
Dieses studentische Skript erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist keine Garantie zum Bestehen irgendwelcher Prüfungen. e-politik.de ist bemüht, die Skripten ständig zu aktualisieren und inhaltlich zu bearbeiten.
|
|
|

|
|
|

 Suche:
(Hilfe) Suche:
(Hilfe)
 Netzreportagen Netzreportagen
 Deutschland Deutschland
 Europa Europa
 USA USA
 Andere Länder Andere Länder
 Organisationen Organisationen
 Medien Medien
 Gesellschaft Gesellschaft
 Studium Studium
 LINKS der WOCHE LINKS der WOCHE








|


