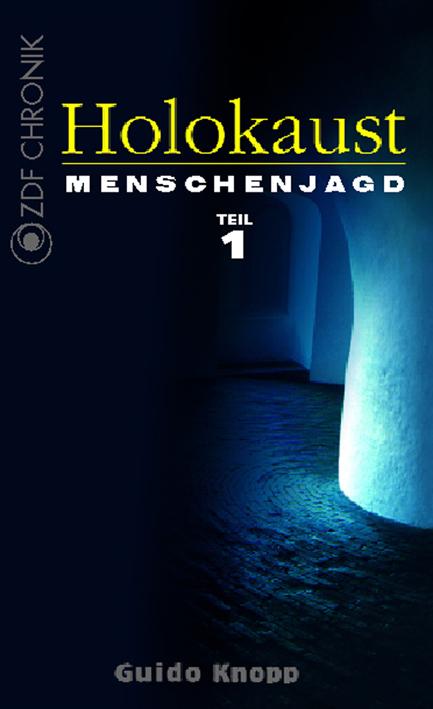
Holokaust - ein notwendiges Stück Fernsehdokumentation
Autor : Christine Frühholz
E-mail: redaktion@e-politik.de
Artikel vom: 07.12.2000
Die Dokumentation "Holokaust" von Maurice Philip Remy, die wöchentlich im ZDF ausgestrahlt wurde, ist nun auch auf Video erhältlich. Ein filmisches Dokument der Zeitgeschichte, das als Vermächtnis verstanden werden sollte, meint Christine Frühholz.
"Holokaust", produziert unter der Leitung von Guido Knopp, Autor zahlreicher preisgekrönter Fernsehsendungen und Chef der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte, unterstreicht auf bisher einzigartige Weise, dass der Holocaust zum Synonym für all das geworden ist, was der Mensch dem Menschen antun kann.
"Ich habe 'Menschenjagd' gesehen - und bin verstummt", sagt Schriftsteller Ralph Giordano, der selbst den Holocaust überlebte, zur ersten Folge. Eine Erfahrung, die viele andere mit ihm teilen. Denn diese Reihe konfrontiert den Zuschauer mit 200 Minuten nie gezeigtem Filmmaterial aus der Nazizeit, die einem den Atem stocken lassen: Heimlich gedrehte Amateuraufnahmen aus Ghettos, von Pogromen, öffentlicher Judenhetze, von Erschießungen und Abtransporten in die Lager lösen Fassungslosigkeit über das damals Geschehene aus.
Sechs Kapitel des Grauens
Gemäß den Titeln der einzelnen Folgen - Menschenjagd, Entscheidung, Ghetto, Mordfabrik, Widerstand und Befreiung - werden die Etappen des Vernichtungsplans der Nationalsozialisten chronologisch aneinandergereiht: Von Hitlers Überfall auf die Sowjetunion 1941 bis zur Befreiung der Konzentrationslager 1945. Aussagen von Opfern wie Tätern machen in jeder dieser sechs Folgen betroffen.
"Wir haben darüber keine Träne vergossen, aber wir haben uns schuldig gefühlt", kommentiert etwa ein Wehrmachtssoldat, der zur Ermordung von Kindern in den Wäldern nahe der ukrainischen Stadt Bjelaja-Zerkov abkommandiert war. "Schließlich mussten wir ja tun, was befohlen wurde... Wir zielten immer ins Herz, damit sie sofort tot waren."
Auch die Äußerung eines deutschen Besatzungsbeamten in Ostpolen, der für Holokaust erstmals öffentlich über seine Erlebnisse spricht, bleibt im Gedächtnis: Hatte er die Juden an sich "für etwas Minderwertiges" gehalten, änderte 1942 ein Erlebnis in Zloczow in Ostpolen seine Einstellung: Er wurde Zeuge, als die SS mit dem Befehl der Ghettoräumung die Juden zum Bahnhof trieb. Direkt vor seiner Tür wurde eine jüdische Frau niedergeschossen. Ihre Leiche blieb einfach im Rinnstein liegen, während die anderen auf Lastwagen verladen wurden. "In dem Augenblick habe ich es schlagartig gefühlt: Es sind Menschen, es sind Menschen wie Du und ich. Die Juden sind nicht unser Unglück, sondern wir sind es selbst, wir richten uns selber zu Grunde."
Mit diesen und weiteren zahlreichen Aussagen von Tätern wie auch Opfern dokumentiert die Reihe - in dieser Authentizität bisher unerreicht - die ganze Tragweite von Hitlers Vernichtungsmaschinerie. Weltweit wurden mehr als 500 Zeitzeugen befragt - das Leid erhält damit nicht nur Stimme, sondern auch Gesicht.
Von Holocaust zu Holokaust
Das k in "Holokaust" rief und ruft zunächst Verwunderung hervor. Schließlich hatte man sich seit dem 1979 ausgestrahlten amerikanischen Fernsehfilm Holocaust an den Anglizismus gewöhnt. Die Übertragung in die deutsche Schreibweise war jedoch ein sehr bewusster Schritt: Nicht nur, dass bereits 1871 in einem deutschen Fremdwörterbuch das Wort Holokaust im Sinn von Großbrand, Massaker oder Gemetzel auftaucht. Es ist vor allem der "symbolische Akt der Aneignung der eigenen Geschichte", so der Historiker Eberhard Jäckel, der die Macher von Holokaust dazu bewegt hatte.
Gegen das Vergessen oder "Nicht schon wieder"?
Als Maurice Philip Remy sein Vorhaben, eine umfassende Dokumentation zum Holocaust zu produzieren, vorstellte, begegneten ihm häufig Reaktionen wie "schon wieder etwas dazu?".
Die zunächst ablehnenden Reaktionen stehen für eine Einstellung zur deutschen Vergangenheit und deren Verarbeitung, wie sie wohl am prägnantesten der Schriftsteller Martin Walser anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1998 auf den Punkt gebracht hatte. Walser hatte in der Paulskirche zum Entsetzen vieler Anwesenden deutlich gemacht: "Kein ernstzunehmender Mensch leugnet Auschwitz; kein noch zurechnungsfähiger Mensch deutelt an der Grauenhaftigkeit von Auschwitz herum; wenn mir aber jeden Tag in den Medien diese Vergangenheit vorgehalten wird, merke ich, dass sich in mir etwas gegen diese Dauerpräsentation unserer Schande wehrt. Anstatt dankbar zu sein für die unaufhörliche Präsentation unserer Schande, fange ich an wegzuschauen."
Der darauf folgende heftige und konträr geführte Diskurs Walsers mit Ignatz Bubis spiegelte den Riss wider, der durch die deutsche Bevölkerung geht, wenn es um die Verarbeitung der eigenen Geschichte geht. Walser wird demnach von der Dokumentation "Holokaust" alles andere als angetan sein. Doch was kann den Kritikern dieser Art der medialen Vergangenheitsbewältigung entgegnet werden?
Eine Umfrage des Emnid-Instituts vom Januar 2000: Demnach können zwei Drittel der 14- bis 18-Jährigen mit dem Wort Holocaust überhaupt nichts anfangen. Bei den Volks- bzw. Hauptschülern sind es sogar 86 Prozent, die vom Ausmaß der Massenermordung der Juden nichts wissen. Und bei den Jugendlichen mit Abitur sind es immerhin noch 43 Prozent, die mit diesem Wort nichts verbinden.
Maurice Philip Remy hat seinen Ehrgeiz zur Produktion dieser Reihe vor allem anhand eines Interviews mit einem Überlebenden des Holocausts gestärkt. Hans Frankenthal ist 73 Jahre alt geworden und hat Auschwitz und den Todesmarsch überlebt. 1999, fünf Monate nach dem Gespräch mit Remy ist er verstorben. Stellvertretend hat er ihm eine Botschaft hinterlassen, die wir alle als Appell betrachten sollten: "Ich liebe Deutschland, ich liebe dieses Land. Hier kann man gut leben. Ich liebe das Land, es muss nur aufgepasst werden, dass dieses Land nicht wieder Dummheiten macht. Das können wir verhindern. Sie, ich, Ihr Kameramann, sein Assistent..."
Unter diesem Aspekt sollten Kritiker des Publizisten Guido Knopp ihren Standpunkt überdenken. Sicherlich, "Holokaust" reiht sich in Knopps mediale Highlights der Aufbereitung von Geschichte nahtlos ein. Er versteht es, wissenschaftliche Recherchen publikumswirksam auf den Bildschirm zu bringen und dabei seinen Namen zum Programm zu machen. Was aber berechtigt kleingeistige Kritik angesichts des Themas, das Knopp hier aufgegriffen hat?
Deutschland ist gerade jetzt, da Bilder von Neonazi-Aufmärschen wieder um die Welt gehen, reif gewesen für eine solche Dokumentation mit Signalwirkung, aber auch für den "wesentlichen Brückenschlag gemeinsamer Erinnerung an das düstere Kapitel in der Geschichte der beiden Völker", wie Knopp sich ausdrückt. "Holokaust" wird neben vielen europäischen Ländern auch in Israel ausgestrahlt und Simon Wiesenthal, der Schirmherr dieser Reihe resümiert: "Ich wünsche mir, dass vor allem möglichst viele junge Leute in aller Welt zuschauen. Sie sind es, die sagen können: ‚Wir leben in einem neuen Jahrhundert. Lasst uns darauf achten, dass sich der Hass in unserem Jahrhundert nicht wieder so ausbreiten kann!'"
"Holokaust" (2000)
seit dem 04. Dezember 2000 als Kaufkassette erhältlich
Buch und Regie: Maurice Philip Remy in Zusammenarbeit mit Stefan Brauburger
Leitung: Guido Knopp
Schirmherrschaft: Simon Wiesenthal
Redaktion: Stefan Brauburger
Eine Produktion der MPR Film und Fernseh Produktions GmbH im Auftrag des ZDF in Koproduktion mit ARTE, Phoenix, The History Channel (USA), EO (Niederlande), ORF und SBS (Australien)
Foto: Copyright liegt bei BMG Video Universum Film.
|
|
|

|
Weiterführende Links:
Die ZDF-Produkte zu Holokaust
Das ZDF zur Schreibweise von Holokaust
|


