|

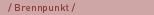
 Afrika
Afrika
 Balkan
Balkan
 China / Russland
China / Russland
 Europa
Europa
 Internationales
Internationales
 Politik in Deutschland
Politik in Deutschland
 Politik und Wirtschaft
Politik und Wirtschaft

 Lehrredaktion
Lehrredaktion
 e-Demokratie
e-Demokratie
 Medien
Medien
 Extremismus im Netz
Extremismus im Netz

 TV / Hörfunk-Tipps
TV / Hörfunk-Tipps
 Pop & Politik
Pop & Politik

 Sport
Sport
 Satire
Satire
 Netz-Fundstücke
Netz-Fundstücke


 Außenpolitik der BRD
Außenpolitik der BRD
 Europäische Union
Europäische Union
 Theorien
Theorien
 Organisationen
Organisationen
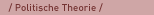
 Antike
Antike
 Neuzeit
Neuzeit

 Parteien
Parteien
 Institutionen
Institutionen

 Aus den Hochschulen
Aus den Hochschulen
 Studienhilfen
Studienhilfen
 Für Studenten
Für Studenten




 Über uns
Über uns
 Presse / Referenzen
Presse / Referenzen
 Redaktion
Redaktion
 Gästebuch
Gästebuch
 Impressum
Impressum

 Jobs@e-politik.de
Jobs@e-politik.de
 Werbung
Werbung
 Partner
Partner
|
Links zu Bildungspolitik in unserer Netzbibliothek
Bildungs- und Hochschulpolitik
Erfurt und die Bildungspolitik
Autor : David Wolf
E-mail: redaktion@e-politik.de
Artikel vom: 18.06.2002
Die Bluttat von Erfurt führte zu einer Debatte um das Waffenrecht und Gewalt in den Medien. Doch auch im aktuellen Streit um unser Bildungssystem muss Erfurt noch eine Rolle spielen, meint David Wolf und kommentiert.
Was würden Eltern sagen, wenn sie mit der folgenden Situation
konfrontiert wären: Da besucht ihr Kind acht Jahre lang ein Gymnasium,
lernt, schreibt Klausuren, steht kurz vor dem lang ersehnten Abitur,
investiert also einen Großteil seines jungen Lebens in die Schule und
dann der große Knall:
Schulverweis, keine Zulassung zum Abitur.
Was mag da im Kopf des Schülers vorgehen ? Urplötzlich scheint sein
Lebensweg verbaut, seine Ziele, vielleicht in Form eines Studiums,
unerreichbar.
Schüler aus Baden-Württemberg beispielsweise hätten in solch
einer Situation immerhin noch den "Trumpf" des in Klasse 10 erreichten
Realschulabschlusses im Ärmel. Nicht aber Schüler aus
Thüringen. Wer dort nicht zur Abiturprüfung zugelassen wird,
besitzt auch in Zukunft keinerlei schulischen Abschluss. Eine
reaktionäre Handhabe, die ihresgleichen sucht. Und mit Eigenwerbung
für den Besuch eines thüringischen Gymnasiums hat das schon gar
nichts zu tun. Was bewirken da die "Hilfen in Schullaufbahnfragen", die auf
der Webseite des thüringischen Kultusministeriums angeboten werden,
wenn sie diesen wesentlichen Punkt außer Acht lassen und keine
Klarheit darüber schaffen, was es bedeutet, wenn ein Schüler
nicht zum Abitur zugelassen wird. Offensichtlich ist die politische Sorge zu
groß, dass viele Eltern ihre Kinder dann gar nicht mehr aufs Gymnasium
schicken. Und auch die Möglichkeit, ab der 11. Klasse extern die
Realschulprüfung abzulegen, tröstet über diese
bildungspolitischen Missstände nicht hinweg.
Klingt es nicht wie eine eingestandene Bankrotterklärung für das eigene Schulsystem, wenn
die Lehrer Robert S. den Wechsel auf ein Gymnasium in ein anderes Bundesland
nahe legten?
Notwendigkeit einer bildungspolitischen Reformdebatte
Eines muss aber auch klar sein: Eine solche Tat, wie sie Robert S. begangen
hat, lässt sich nicht ausschließlich durch eine fehlgeleitete
Schul- und Bildungsorganisation rechtfertigen. Da kommen andere Motive und
Einflüsse hinzu, die ein solches Verhalten ermöglichen. Die von
der Regierung eingeleiteten Schritte zur Eindämmung von Gewalt in den
Medien gehen sicherlich in die richtige Richtung, aber sie greifen allein zu
kurz.
Nötig sind zusätzliche Überlegungen, die auf eine
verstärkte pädagogische Betreuung solcher "Problemkinder"
abzielen. Schule sollte nicht allein als ein Ort verstanden werden, an dem
nur Lernstoff vermittelt wird, sondern sie sollte auch stärkere
erzieherische Funktionen erhalten. Die Probleme ihrer Schüler
aufgreifen und diesen mit pädagogischen und erzieherischen
Maßnahmen begegnen, so muss das neue Bild von Schule in der Zukunft
aussehen, und das gilt um so mehr in einer Zeit, in der jugendliche
Schüler mehr und mehr den Kontakt zur sozialen Clique suchen als zur
Familie oder zur Schule.
In einer Zeit, in der viele durch immensen
Medienkonsum zunehmend orientierungslos werden und für die die Grenze
zwischen Realität und Fiktion immer mehr verschwimmt. Diese Diskussion
muss dann notwendigerweise auch die Frage nach anderen Schulformen
beinhalten, denn "gewöhnliche" Schulen des dreiteilig gegliederten
Schulsystems haben für eine solche zusätzliche Betreuung nicht die
organisatorischen und didaktischen Möglichkeiten.
Es steht also wieder einmal das Thema "Gesamtschule" auf dem Plan. Ein Schulkonzept, das auf
Miteinander, nicht auf Konkurrenz, auf Verschiedenheit der Schüler,
nicht auf durch krampfhafte Auslese erzwungene Homogenität, auf
sozialpädagogische Unterstützung, nicht auf pure Stoffvermittlung,
angelegt ist.
Wer weiß, Robert S. wäre es auf einer solchen
Schule vielleicht besser ergangen, hätte man sich seiner Probleme
angenommen und ihm nicht durch Schulverweis jegliche schulische
Abschlusshoffnung genommen. Das Drama hätte es so vielleicht nie gegeben.
|
|
|

|
Weiterführende Links:
Freistaat Thüringen
Initiative ´Schule in der Zukunft`
Leserkommentar
von
Thomas Bauer
am 19.06.2002
|
|
Erziehung muss zu Hause beginnen
Dass das Massaker von Erfurth die Lücken in unserem Bildungssystem offengelegt, dürfte in dieser Hinsicht unumstritten sein. Daraus aber den Ruf nach einer Gesamtschule zu machen, scheint mir der falsche Weg. Zwei Gründe stehen meiner Meinung nach einem Erfolg der Gesamtschulen im Weg. Zuerst einmal muss gesagt werden, dass Gesamtschulen nur für einen bestimmten Bereich des Lern-Niveaus tauglich ist. Schüler, die sich unter- bzw. überfordert sehen, dürften sich auch von einer Gesamtschule im Stich gelassen fühlen. Zweitens sollte der erzieherische Cahrakter mehr zu Hause als in der Schule gesucht werden. Lehrer sind keine Seelsorger oder psychologische Fachärzte, ihr Job ist es, die neusten Erkenntnisse im Rahmen einer gutfunktionierenden Wissensvermittlung "an den Mann" zu bringen. Aber niemand kennt sein Kind besser als die eigenen Eltern, die ja bis zum "Problemalter" von 12-14 Jahren genügend Erfahrung mit den Vorzügen, Sprgen und Ängsten ihrer Kinder gesammelt haben...oder zumindest hätten sollen. Denn hier liegt die Krux der ganzen Sache. Eltern wollen und können ihre Kinder nicht mehr verstehen, da sie selbst einem mörderischen Leistungsdruck und immer größeren Belatungen im Arbeitsleben ausgesetzt sind. Ganz schlimm sieht es hier bei Familien mit Doppelverdienern aus. Vor 18.00 Uhr bekommen die Kinder ihre Eltern nicht zu sehen. Nebenebie liegt auch hier der größte Anteil der deutlich fettleibigen Kindern. Eltern schaffen es hier nicht einmla mehr ihren Kindern vernünftiges Essverhlaten beizubringen. Ergebnis. MacDonalds, Cola und Co. vernichten schon den Ansatz einer erfolgreichen Erziehung. Um 13.00 Uhr in die Stadt ins Spielzentrum, schnell einen Burger reinschieben, Hausaufagebn Fehlanzeige, und an Abend haben die Eltern logischerweise keinen Bock mehr nach einem langen Arbeitstag sich die Hausaufgaben der Kinder anzusehen, geschweige denn zu überprüfen, ob die überhaupt in der Schule waren. Erfurth ist und bleibt also ein Indiz für ein gesellschaftliches Problem, das auch den Bildunsgbereich betrifft, aber bereits bei "Haus und Hof" beginnt.
|
|
[ mehr Kommentare ]
[ eigenen Kommentar abgeben ]
|
|
|

 Suche:
(Hilfe) Suche:
(Hilfe)
 Netzreportagen Netzreportagen
 Deutschland Deutschland
 Europa Europa
 USA USA
 Andere Länder Andere Länder
 Organisationen Organisationen
 Medien Medien
 Gesellschaft Gesellschaft
 Studium Studium
 LINKS der WOCHE LINKS der WOCHE








|


