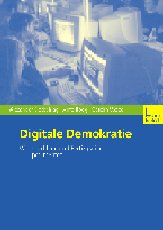
Alexander Siedschlag, Arne Rogg und Carolin Welzel: Digitale Demokratie
Autor : Jochen Groß
E-mail: redaktion@e-politik.de
Artikel vom: 29.07.2002
Wie sich politische Partizipation durch das Internet verändert und organisieren lässt, gehört zu den zentralen politischen Zukunftsfragen. Nun ist eine erste Bestandsaufnahme publiziert worden. Jochen Groß fasst zusammen.
Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zu ihren Politikern ist mit der zunehmenden Ausbreitung des Internets gehörig in Bewegung geraten. Der bereits laufende Wahlkampf wird der erste sein, der zwar nicht im Netz gewonnen, aber schon verloren werden kann. Dabei muss das Online-Angebot der Parteien - und auch der politischen Institutionen - längst deutlich über die bloße Existenz einer Homepage hinausgehen. Partizipation und Responsivität sind die entscheidenden wissenschaftlichen Schlagwörter. Die Möglichkeiten politischer Bürgerbeteiligung und ein offenes Ohr der Politik für die Anliegen der Bürger müssen die modernen Internetangebote auszeichnen, sollen sie vom Bürger wahr- und ernstgenommen werden. Mit einfachen Foren oder gelegentlichen Chats ist es längst nicht mehr getan. Bei einigen Parteien kann man schon sehen, wohin die Reise gehen wird: das Netz als zusätzliches Wahlkampfinstrument mit hoher Geschwindigkeit als online-Spendensammelforum oder als Plattform für virtuelle Parteitage.
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
Darüber hinaus stellt das Internet aber auch die gesamte Demokratie vor große Aufgaben. Der Partizipations- und Willensbildungsprozess wird sich in Folge der Ausbreitung des Internets und der vergrößerten technischen Möglichkeiten rapide verändern. Die Politik darf auf diese grundlegenden Veränderungen nicht nur reagieren, sondern muss sie gestalten und dabei vielfältige und komplexe Probleme mit berücksichtigen. Auf der einen Seite sind dies technische Beschränkungen und rechtliche Normen, wie der Datenschutz, der auch zukünftig gewahrt werden muss. Zum anderen darf aber auch eine gesamtgesellschaftliche Perspektive nicht ausgeblendet werden. Hier muss vor allem der drohenden "globalen digitalen Spaltung" entgegen gewirkt werden. Der nun vorliegende Band, der im Rahmen der jüngst gegründeten Ad-hoc-Gruppe "Internet und Politik" der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft erschienen ist, liefert erste Ansätze zum Umgang mit diesen hochkomplexen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Aufräumen mit gängigen Ideologien
Zunächst geisterte eine euphorische Stimmung durch die Lande, das Internet wurde als herrschaftsfreier Raum gefeiert und als demokratieförderndes Medium (Net empowerment) betrachtet. Legitimitätsdefizite westlicher Demokratien würden sich praktisch von selbst erledigen mit der technischen Erneuerung des politischen Systems. Zu diesen prophetischen Weissagungen, gesellten sich schnell auch kritische Töne, Warnungen vor einer "digitalen Spaltung" der Bevölkerung und übersättigten digitalen Demokratien, in denen traditionelle demokratische Institutionen niedergingen. Aus diesen zum Teil schnell erhobenen Ad-hoc-Theorien haben sich mittlerweile verschiedene Modelle und auch handfeste Thesen herausgebildet, die der Komplexität der Aufgabe einer internetvermittelten Politik deutlich gerechter werden.
Siedschlag, Rogg und Welzel zeigen anhand einschlägiger Beispiele aus den USA, Großbritannien und auch Deutschland plastisch die Chancen und Risiken der existenten Ansätze internetvermittelter Politik auf. Dabei kristallisiert sich heraus, dass vor allem die so genannte Verstärkungshypothese Erklärungskraft besitzt. Demnach ist das Internet vor allem ein guter Weg, aufgeschlossene Menschen auf attraktive Weise mehr und näher an Politik heranzuführen. "Wer schon überdurchschnittlich gut sozial vernetzt, politisch motiviert und aktiv ist, schöpft auch die Möglichkeiten des Internets aus; wer es aber nicht ist, wird es auch durch das Internet nicht", so die zentrale Erkenntnis der Studie. Das Internet per se kann also nicht Initiator für mehr Bürgerbeteiligung und Legitimationszugewinne politischer Systeme sein, sondern es müssen die nach wie vor strukturellen Faktoren wie fehlendes politisches Interesse oder mangelnde Beteiligungschancen überwunden werden. Das Internet jedoch liefert hier durch neue Möglichkeiten der Vermittlung und Beteiligung gute Ansatzmöglichkeiten - vorausgesetzt, die Verbreitung nimmt weiter zu und durchdringt alle Bevölkerungsteile gleichermaßen.
Gefordert: Eine zukunftsfähige und -willige Politik mit Augenmaß
Dieses Buch ist ein wichtiger Beitrag im Rahmen der Diskussion um die Zukunft der Demokratie. Denn die Frage nach der systemischen Veränderungen ist weitaus weniger akademisch als es zunächst erscheinen mag. Vielmehr stellen die technischen Veränderungen die Politik vor große praktische Herausforderungen und bieten gleichermaßen viele neue Möglichkeiten der Bürgerbeteilung. Wichtig ist, dass die Politik auf die technologischen Entwicklungen nicht nur mit althergebrachten Mitteln reagiert, sondern jenseits der Parteigrenzen aktiv neue Wege findet, um die sich bietenden Chancen wahrzunehmen und die Legitimität der Demokratie zu stärken. Eine blinde Technologiegläubigkeit wäre in ihren Auswirkungen ebenso deplatziert wie eine übertriebene Internetfeindlichkeit, die Politik nicht reformiert sehen will.
Alexander Siedschlag, Arne Rogg und Carolin Welzel: "Digitale Demokratie. Willensbildung und Partizipation per Internet"
Leske + Budrich, Opladen, 2002, 115 Seiten
9,90 EUR
ISBN 3-8100-3432-0
Bild: Das Copyright liegt bei dem Verlag Leske + Budrich
|
|
|

|
Weiterführende Links:
Ad-hoc-Gruppe Internet und Politik
|


