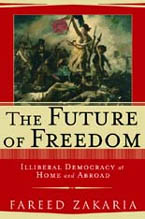
Von Freiheit und Demokratie
Autor : Werner Schäfer
E-mail: redaktion@e-politik.de
Artikel vom: 23.07.2003
In seinem Buch The Future of Freedom warnt der amerikanische Journalist Fareed Zakaria vor zu viel Demokratie. Ohne Freiheit und Rechtsstaat hält er sie für gefährlich. Von Werner Schäfer.
Demokratie ist gut. Das weiß heute jedes Kind. So gut sogar, dass sich selbst diejenigen, die sie verachten, mit ihrem Namen schmücken, von der Demokratischen Republik Kongo bis zur Demokratischen Volksrepublik (Nord-)Korea. Doch trotz oder gerade wegen dieses guten Rufes sieht Fareed Zakaria die größte Herausforderung unserer Zeit in Umkehrung der Wilsonschen Formel darin "to make democracy safe for the world."
Damit wendet sich der Newsweek-Redakteur und Kolumnist, der in Washingtoner Kreisen bisweilen als zukünftiger Nationaler Sicherheitsberater und damit als Nachfolger von Condoleezza Rice gehandelt wird, gegen einen Zeitgeist, der in der Demokratie die Lösung aller politischer Probleme sieht. Ein gewachsenes kapitalistisches System als ökonomischer Unterbau und die damit einhergehende Entwicklung des Rechtsstaates - der "rule of law" - sind für ihn unabdingbare Vorraussetzungen für das Funktionieren einer Demokratie, die sowohl eine effiziente Regierung hervorbringt, als auch die Grundrechte von Einzelpersonen und Minderheiten achtet und schützt.
The rise of illiberal Democracy
Zakarias Kritik zielt vor allem auf die in den späten 80er Jahren aufgekommene Praxis des Westens, überall auf der Welt Wahlen zu fordern und allein an deren Durchführung die Legitimität von Regierungen zu messen. Häufig kamen bei solchen Wahlen nämlich Regenten an die Macht, die nach westlichen Standards ganz und gar undemokratisch waren. So entschied sich die gewählte Regierung Ruandas für den Völkermord an den Tutsi, Serben und Kroaten erkoren Nationalisten vom Schlage Tudjmans und Milosevics zu ihren Führern, und selbst der Darling des Westens - Boris Jelzin - nahm es weder mit der Pressefreiheit noch mit den Rechten seines Parlaments so besonders genau.
Zakaria beschreibt dieses Phänomen als "rise of illiberal democracy", als Demokratie ohne Freiheit. Auf das Spannungsverhältnis von Demokratie und Freiheit hatten zwar politische Philosophen von Aristoteles bis Tocqueville hingewiesen, doch geriet es in Vergessenheit, da die Demokratisierung des Westens mit einer umfassenden Liberalisierung der Gesellschaft einherging. Während die Beteiligung des Volkes an der Politik zunahm, wurde die Allmacht des Staates durch Verfassungen, Gesetze und den Aufbau privaten Reichtums eingeschränkt. In den jungen, von Zakaria kritisierten Demokratien herrschte der Staat und damit die jeweils gewählte Regierung praktisch uneingeschränkt. Demokratie ohne Freiheit folgte auf dem Fuß.
Voraussetzungen für liberale Demokratie
Ein paar echte Demokratien haben die letzten zwei Jahrzehnte dennoch hervorgebracht, in Chile, Taiwan und Südkorea zum Beispiel. Doch dort gingen der Demokratisierung Jahrzehnte wirtschaftlichen Wachstums voraus, welches zur Entstehung einer finanziell unabhängigen Mittelklasse und rechtsstaatlicher Strukturen führte. Außerdem verfügten diese Länder über staatliche Institutionen, die - allein schon um wirtschaftliches Wachstum zu ermöglichen - den Bürgern gewisse Freiheiten gewährten. Als dann die ersten freien Wahlen abgehalten wurden, war jedermann klar, dass die Gewählten nicht nach Gutdünken würden herrschen können.
Arme Länder haben also laut Zakaria so gut wie keine Chance, den Übergang zur Demokratie erfolgreich zu gestalten. Ihren Gesellschaften fehlt die notwendige Unabhängigkeit um sich vor gewählten Despoten zu schützen. Dies gilt auch und gerade für Länder, die reich an Bodenschätzen sind, also für den Großteil des Nahen Ostens. Da deren Reichtum nicht produziert werden muss, gibt es für die Inhaber der Macht keinen Anreiz, diese zu teilen. Folglich entsteht keine Marktwirtschaft, keine Mittelschicht und keine stabile Demokratie.
Die Probleme Amerikas
Besonders interessant wird Zakarias Buch, wenn er über die USA schreibt. Dort gibt es zwar seit Jahrzehnten hohe Wachstumsraten und einen nahezu missionarischen Glauben an die Demokratie. Doch das Vertrauen in die eigenen demokratischen Institutionen ist seit den 60er Jahren kontinuierlich gesunken. Dies erklärt Zakaria wiederum mit zu viel Demokratisierung. Im Kongress werde immer weniger über Gesetze und deren öffentlichen Nutzen debattiert. Stattdessen hänge alles von Meinungsumfragen und dem Einfluss geschickter Lobbyisten ab, die durch (im Namen von Demokratie und Tansparenz) öffentlich abgehaltene Ausschusssitzungen noch mächtiger wurden.
Ungenauigkeiten
Zakarias Buch ist sehr lesbar und argumentativ überzeugend geschrieben. Allerdings haben sich in den Text auch einige peinliche Ungenauigkeiten eingeschlichen. So stellt er die Machtergreifung Hitlers als das Ergebnis freier Wahlen dar, obgleich die Realität um einiges komplexer aussah. Auch der indonesische Diktator Suharto gerät in ein allzu positives Licht, wenn der dortige Ausbruch von Chaos 1998 allein auf eine zu schnelle Demokratisierung geschoben wird. In seinen Kapiteln über Amerika spricht Zakaria auch allzu großzügig über das vermeintlich goldene Zeitalter der amerikanischen Demokratie, die 50er und 60er Jahre, die für Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe alles andere als golden waren.
Trotz dieser Schwächen ist The Future of Freedom ein gelungenes und wichtiges Buch. Wie die internationale Gemeinschaft auf dem Balkan und in Afghanistan gelernt hat, funktioniert Demokratie nur unter bestimmten Bedingungen. Zakaria erklärt auf elegante Weise, welche dies sind und warum.
Fareed Zakaria: The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad.
W.W. Norton & Company, New York, 2003
Copyright des Bildes liegt bei W.W. Norton & Company
|
|
|

|
|


