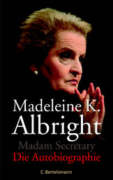
Madeleine K. Albright: Die Autobiografie
Autor : Michael Kolkmann
E-mail: redaktion@e-politik.de
Artikel vom: 15.10.2003
Bill Clintons Außenministerin Madeleine K. Albright hat ihre Autobiografie veröffentlicht. Von Michael Kolkmann.
Als Madeleine Albright am 23. Januar 1997 als erste Außenministerin der Vereinigten Staaten vereidigt wurde, übernahm sie ein Amt, das zu erreichen sie lange Zeit für unmöglich hielt: "Bis weit in mein Erwachsenenalter hinein war im Grunde nicht vorgesehen, dass ich wurde, was ich wurde", so Albright in ihrer kürzlich auf Deutsch veröffentlichten Autobiografie.
Und in der Tat war wohl nicht abzusehen, dass die Tochter von Josef und Anna Körbel, die im Jahre 1937 in Prag geboren und Marie Jana genannt wurde, einmal Außenministerin der Vereinigten Staaten werden würde.
Ein persönliches Buch
Der originalsprachliche Titel der Biografie, "Madam Secretary", lässt vermuten, dass Albright hauptsächlich über ihre vier Jahre als amerikanische Außenministerin schreibt. Der deutsche Titel ist passender: "Die Autobiografie" lautet er schlicht und einfach. Und in der Tat sind die interessantesten Passagen diejenigen, in denen Albright über ihr persönliches Leben berichtet. Als Kind musste sie mit ihren Eltern - ihr Vater war im diplomatischen Dienst der Tschechoslowakei - vor dem Zweiten Weltkrieg vor den Nazis fliehen, nach dem Krieg dann vor den Kommunisten. Über die Stationen Genf und London gelangte die Familie in die USA. Ganz bewusst verbindet Albright diese eher persönlich gehaltenen Passagen mit ihren jeweiligen Tätigkeiten inner- wie außerhalb der Regierung: "Ich wollte das Persönliche mit dem Politischen verbinden, nicht nur beschreiben, was geschehen war, sondern auch schildern, wie und warum der Gang der Geschichte von den Beziehungen zwischen Menschen beeinflusst wurde", so Albright.
Später Karrierestart
Nach Konzentration auf ihre Rolle als Ehefrau eines bekannten Journalisten und Verlegers und Mutter von drei Kindern setzt Madeleine Albright verhältnismäßig spät zu ihrer eigenen Karriere an, die dann aber um so schneller verläuft. Doktorarbeit im Alter von fast vierzig Jahren, Tätigkeit im Nationalen Sicherheitsrat im Weißen Haus, Professorin an der Georgetown University, UN-Botschafterin der Vereinigten Staaten - sie habe "eben fünfundzwanzig Jahre gebraucht, um über Nacht Karriere zu machen", scherzt sie im Vorwort.
Detaillierte Einblicke
Mit dem Hauptteil der Biografie, der Albrights Tätigkeit als UN-Botschafterin und dann als US-Außenministerin behandelt, geraten die Konfliktfelder der 1990er Jahre ins Blickfeld: Somalia, Haiti, Ruanda, der Balkankonflikt, der Nahost-Friedensprozess, die Situation im Irak und Auseinandersetzungen mit China, Kuba, Libyen und Nordkorea - das Buch ist eine Tour de Force durch alle politischen und militärischen Konflikte der neunziger Jahre. Ebenfalls im Mittelpunkt stehen die regierungsinternen Auseinandersetzungen um den jeweils richtigen politischen Kurs. Hier musste sich Albright als Außenministerin vor allem mit dem jeweiligen Verteidigungsminister sowie den Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrates auseinandersetzen. Detailliert lässt sie den Leser hinter die Kulissen der Macht blicken. Gewürzt ist das Buch zudem mit vielen amüsanten Anekdoten, die das Lesen kurzweilig und spannend machen.
Ein Ausblick fehlt
Das Buch endet mit Albrights Ausscheiden aus der Regierung im Januar 2001. Die nachfolgenden Ereignisse - die Terroranschläge vom 11. September, die Kriege gegen Afghanistan und den Irak - werden abschließend nur am Rande gestreift. Zwar gehört es für emeritierte Politiker zum guten Ton, sich öffentlich nicht kritisch über seine Nachfolger zu äußern, aber zu gern würde der Leser Albrights Einschätzungen der aktuellen weltpolitischen Lage wissen. Auch finden sich in der Autobiografie apologetische Passagen, die das eigene Regierungshandeln im Nachhinein zu rechtfertigen versuchen. So schwärmt Albright etwa davon, unter Präsident Clinton gearbeitet zu haben, "der eine klare Vorstellung von der Rolle Amerikas als einigender Kraft in einer Welt hatte, die mit rasender Geschwindigkeit aus einer alten in eine neue Ära eintrat". Jede nähere Beschäftigung mit der Clintonschen Außenpolitik entlarvt diese Auffassung jedoch als Mythos, war seine Außenpolitik doch gerade in den ersten Amtsjahren eher eine "trial-and-error"-Politik; ein (eher fragmentiertes) Gesamtkonzept kristallisierte sich höchstens in den letzten Jahren seiner Amtszeit heraus.
Ärgerliche Übersetzungsfehler
Zudem trüben einige ärgerliche Übersetzungsfehler den insgesamt positiven Leseeindruck. So ist ein "committee" des Kongresses im Deutschen ein Ausschuss, kein Komitee. Bekannte Organisationen wie der New Yorker "Council on Foreign Relations" muss man nicht zu "Rat für Auswärtige Beziehungen" verunstalten, der Eigenname kann ohne weiteres stehen bleiben. Und wenn jemand im Rahmen einer Stellenausschreibung "resumes" liest, so sind das ganz eindeutig Lebensläufe, keine wie auch immer gearteten "Resümees".
Prädikat: Empfehlenswert
Diese eher nebensächlichen Fehler können das Lesevergnügen allenfalls am Rande beeinflussen. Insgesamt hat Madeleine Albright ein kurzweiliges, fundiertes Buch über die Formulierung und Gestaltung amerikanischer Außenpolitik im politischen System der USA geschrieben. Es ist zugleich das Zeugnis einer beeindruckenden Karriere, die sich über mehrere Jahrzehnte und zwei Kontinente erstreckt. Wer sich ein Bild von amerikanischer Außenpolitik am Ende des 20. Jahrhunderts machen will, wird an Albrights Biografie nicht vorbeikommen.
Madeleine K. Albright:
"Die Autobiografie",
Verlag C. Bertelsmann, München 2003,
676 Seiten, 28 Euro,
ISBN: 3-570-00729-4.
Copyright des Fotos liegt beim Internetangebot des Bertelsmann-Verlages:
www.bertelsmann-verlag.de.
|
|
|

|
Weiterführende Links:
Biografie von Madeleine K. Albright im Netz
Homepage des Verlages
|


