e-politik.de - Artikel
( Artikel-Nr: 775 )Rüdiger Hohls / Konrad H. Jarausch (Hrsg.): Versäumte Fragen - Deutsche Historiker im Schatten des Nationalsozialismus Autor : e-politik.de Gastautor Wirkt sich die Arbeit namhafter Historiker für den Nationalsozialismus auch in der heutigen Geschichtsforschung noch aus? Ein Buch als Ausgangspunkt für viele weitere Fragen. Nikolaus Hochholzer hat es für e-politik.de gelesen. Nachdem nun so langsam alle 50-Jahr-Feiern absolviert waren, Verantwortliche und Politiker Ihre Redemanuskripte abgeheftet hatten, hoffte manch einer, dass mit dem Erinnern Schluss sein möge, dass man nun, mehr als 50 Jahre "danach", seine Ruhe haben möge, vor dem kollektiven Erinnern und Bedauern, von der Dauerbetroffenheit, die vielfach nur noch - verstohlen zugegeben - Heuchelei war.
Emotionale Diskussionen
Ein ganzes Volk ein Volk von Tätern? Vorbei mit dem bequemen Betrauern von Dingen, für die man sich nicht verantwortlich fühlte, weil man entweder der Tätergeneration nicht angehörte, oder nur einer von vielen war, die natürlich von Nichts wussten.
Gerade die filmische "Aufarbeitung", sie begann Ende der 70er Jahre mit den Holocoust-Folgen, sprach natürlich eminent die Gefühlsebene an, und verhinderte so ein schnelles Verdrängen historisch oftmals bekannter Tatsachen.
Die Kritik an der Geschichtsschreibung
Nach und nach geriet aber nun auch, von der breiten Öffentlichkeit fast unbemerkt, eine Wissenschaft in die Kritik, von der man immer nur neutrales Beobachten, Darbieten und Aufarbeiten erwartet. Wie die Physik wertungsfrei gegebene Naturgesetze darzustellen versucht, so erwartete man von der Geschichtswissenschaft, und wenn es nur unterbewusst war, eben das gleiche Vorgehen. Die Historiker begannen, ihre eigene Geschichte in der Zeit zwischen Bismarck und Hitler aufzuarbeiten.
Ausbeutung der Geschichtswissenschaft
Zu Beginn des letzten Jahrhunderts erfolgte in der Geschichtswissenschaft langsam ein Übergang von ideenzentrierter Geschichtsdeutung, hin zu einem volksgeschichtlichen Ansatz, der Vorläufer der heutigen Gesellschafts- bzw. Sozialgeschichte war.
Suchen und Fragen
Dabei wählten die Herausgeber einen, wenn auch nicht neuen, so doch erfrischenden Weg, indem sie nicht Forschung betrieben und anschließend ihre Ergebnisse präsentierten, sondern den Leser teilhaben lassen am Suchen und Fragen. Nach einer knappen aber ausreichenden Ein- und Heranführung an das Thema, kommen nacheinander maßgebende Geschichtswissenschaftler in Interviews zu Wort, die ursprünglich nur im Internet veröffentlicht waren. Diese Interviews mit Helga Grebing, Gerhard A. Ritter, Hans und Wolfgang J. Mommsen, Hans-Ulrich Wehler und Jürgen Kocka - der deutschen Historiker-Equipe also - sind in einen mehr persönlich / biografischen und einen standardisierten, fachbezogenen Fragenteil aufgegliedert.
Nicht selbstgerecht moralisierend
Es ist wichtig, dass die Geschichtswissenschaft untersucht, wie weit sie auch heute noch mit nationalsozialistischem Gedankengut, eventuell sogar systemimmanent, belastet ist. Und hierzu stellt "Versäumte Fragen" einen guten Ausgangspunkt dar.
Rüdiger Hohls / Konrad H. Jarausch (Hrsg.): "Versäumte Fragen - Deutsche Historiker im Schatten des Nationalsozialismus"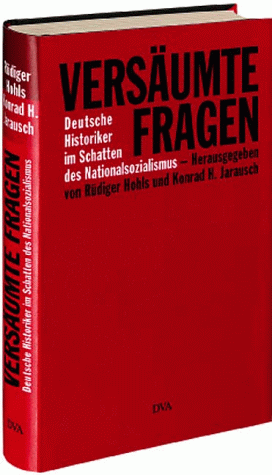
E-mail: redaktion@e-politik.de
Man hatte die üblichen Beileidsbekundungen absolviert, nun ging es wieder fröhlich ans Schmausen. Dann aber schlug Daniel J. Goldhagen zu, und die Aufregung um sein Buch "Hitlers Willing Executers" war groß.
Und nun sollte man einem Volk angehören, in dem ein solcher Wahnsinn von Haus aus grundgelegt war! Die Welle der Empörung schien nicht enden zu wollen. Egal nun, wie berechtigt man Goldhagens These einstufen will, wühlte sie einigen Schlamm im Meer des Vergessens wieder auf; bewirkte sie doch, im Zusammenwirken mit Filmen, wie etwa "Schindlers Liste", eine breitere Diskussion, die offener geführt wurde, weil aus größerer Distanz. Vor allem aber wurde auch emotionaler über die NS-Zeit und die Faktoren nachgedacht, die den Holocaust erst möglich gemacht haben.
Man fand Richter und Staatsanwälte, die im Dritten Reich Recht sprachen und meist sofort oder nach kurzer Schamfrist wieder in Amt und Würden waren. In jüngster Zeit kamen Unterlagen über Ärzte ans Licht, die Patienten gezielt für "Euthanasie"-Projekte weitergaben. Oftmals Dinge, die man wusste, deren Ungeheuerlichkeit einen aber immer wieder aufs Neue erschreckten.
Man versuchte nun zu ergründen, in wie weit sich die Geschichtswissenschaften und -wissenschaflter von der Macht korrumpieren ließen. Aber auch, wie und ob eine Aufarbeitung innerhalb der Geschichtswissenschaften nach der NS-Diktatur erfolgte und ob durch fehlende Aufarbeitung ein "brauner Systemfehler" weitergetragen worden sei. Ein letzter Auslöser für ein Aufflammen dieser Diskussion war der Historikertag in Frankfurt 1998.
Dieser Ansatz, der nun mehr empirisch war, ließ sich vom NS-Regime oftmals gut für dessen Zwecke ausbeuten. So wurden von Historikern, aus welchen Gründen auch immer, Gutachten erstellt, die dem Regime eine Rechtfertigung von Eroberung, Massenumsiedlung und letztendlich Massenvernichtung lieferten. Ob ein solches Regime sich von anders lautenden Gutachten hätte abhalten lassen, sei dahin gestellt.
Angeregt durch die Diskussion am Historikertag in Frankfurt, erschien es den Herausgebern des nun vorliegenden Buches "Versäumte Fragen - Deutsche Historiker im Schatten des Nationalsozialismus" interessant zu untersuchen, ob es ein Weiterwirken von "im NS-Kontext entstandenen Ideen, Konzepten und Methoden in der Nachkriegszeit" gab, in wie weit die moderne Gesellschafts- und Sozialgeschichte dadurch auch heute noch "braun" beeinflusst ist.
Weitere Fragen, im Sinne einer wissenschaftlichen Nabelschau und Selbstbestimmung werden implizit angerissen: Wo steht die Geschichtswissenschaft heute? Wie eng soll der Kontakt zur Politik sein? Wie viel Verantwortung trägt ein Geschichtswissenschaftler mit dem, was er publiziert? Warum haben die nachfolgenden Wissenschaftlergenerationen ihren Vorgängern bezüglich ihrer Vergangenheit keine Fragen gestellt?
Dies bietet dem Leser eher die Möglichkeit, die Antworten und Standpunkte zu werten und einzuordnen. Ein ausführliches und gutes Glossar rundet das Werk ab.
Zu selbstgerecht moralisiernd darf man hier aber sicher nicht werden. Inwiefern kann und darf ich, der ich die Vorzüge eines nicht-totalitären Staates, in dem es wirtschaftlichen Wohlstand in Fülle gibt, jemanden moralisch ab- und verurteilen, dessen damalige Zeit, dessen damaligen kulturellen und sozialen Hintergrund ich, aufgrund meiner vollkommen anderen Situation, nicht einmal erahnen kann?
Es ist, so glaube ich, kaum einer von uns davor gefeit, aus welchen Gründen auch immer, zumindest Mitläufer in einem solchen System zu werden. Ein zu voreiliges, selbstgerechtes Kritisieren von Handlungen in der damaligen Zeit scheint sich mir hier zu verbieten.
Insgesamt ein lesenswert bis spannendes Buch, das allen an der Diskussion Beteiligten zum Einen Orientierungspunkt innerhalb der Debatte, zum Anderen Möglichkeit zur Klärung und Relativierung von Positionen sein kann. Gerade auch für den interessierten Laien bietet sich hier die Möglichkeit, durch den lebhaften Eindruck, sicher nicht neutral erzählter, fast aktueller Geschichte, in die momentan laufende Debatte einzusteigen, vor allem aber genügend Anregung zu weiterem, eigenen Nachforschen, -lesen und -denken.
Deutsche Verlagsanstalt, München, 2000, 300 Seiten
44 DM
ISBN: 3421053413